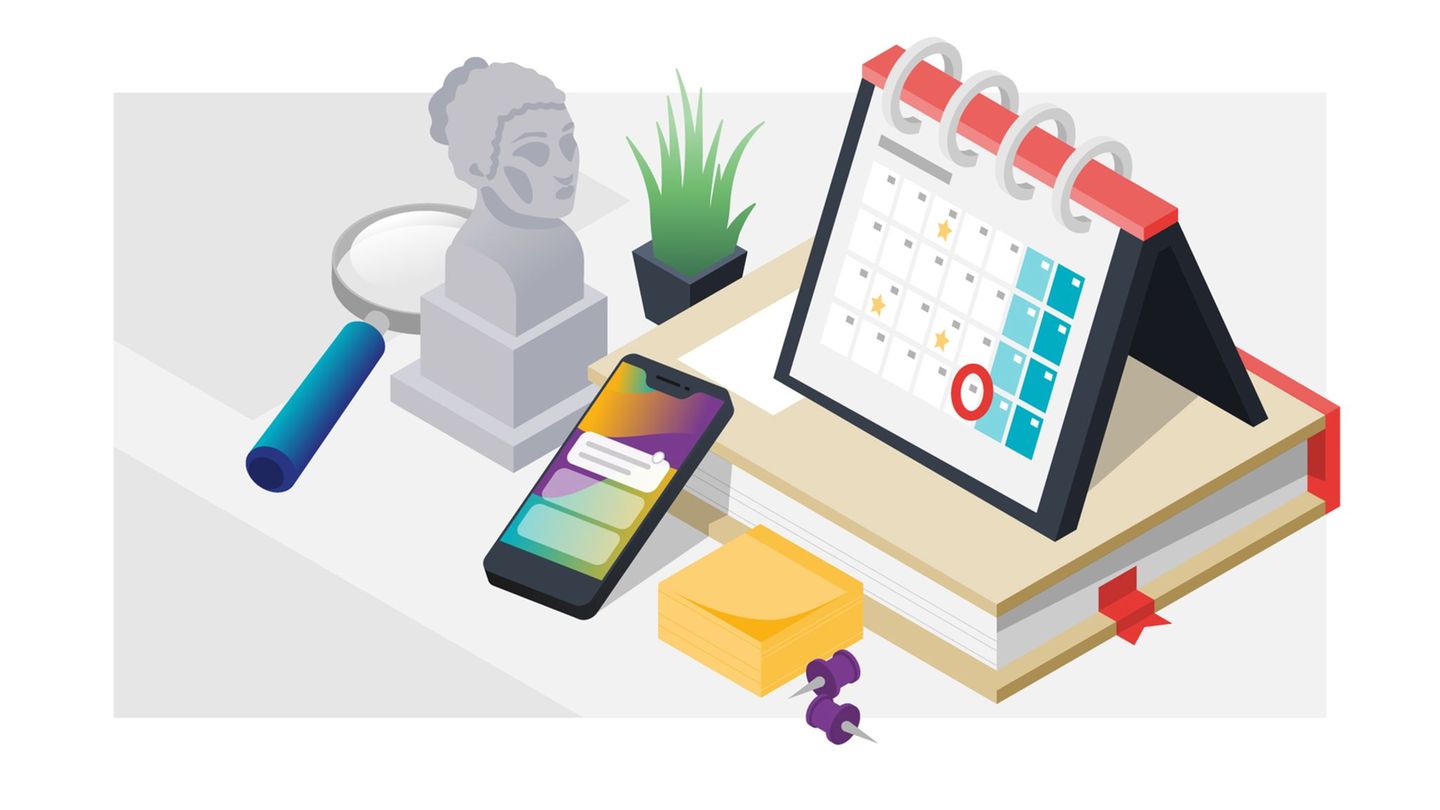„Gesetzeslücke muss geschlossen werden“: Sonja Eichwede, Vizefraktionsvorsitzende der SPD, will einen neuen Straftatbestand gegen verbale sexuelle Belästigung schaffen.
Frau Eichwede, „Catcalling“ ist in Deutschland weit verbreitet, viele Frauen wurden schon Opfer, doch nur wenigen dürfte der Begriff geläufig sein: Wie würden Sie einem Laien erklären, was das ist?
Wir sprechen hier von gezielter, erheblicher, mündlicher sexueller Belästigung. Den umgangssprachlichen Begriff „Catcalling“ halte ich daher für schwierig, weil er ein massives gesellschaftliches Problem verharmlost.
Anzügliche Rufe, obszöne Gesten: Aufgrund der aktuellen Rechtslage kann verbale sexuelle Belästigung nur schwer bestraft werden. Wieso?
Kurz gesagt: Weil verbale sexuelle Belästigung im juristischen Sinne keine Beleidigung oder persönliche Herabsetzung darstellt. Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil von 2017 festgestellt, dass hier eine Gesetzeslücke vorliegt.
In dem besagten Fall hatte ein 65-Jähriger zu einer Elfjährigen gesagt, dass er ihr „an die Muschi fassen“ wolle. Das Gericht sprach den Mann frei, weil diese Äußerung keine „herabsetzende Bewertung des Opfers“ enthalten habe und „bloß sexualbezogene oder grob sexuelle Äußerungen“ nicht vom Straftatbestand der Beleidigung erfasst sind.
Diese Gesetzeslücke muss geschlossen werden. Solch ein Verhalten können wir nicht tolerieren. Es schüchtert die Opfer, in aller Regel Frauen oder Mädchen, massiv ein. Studien zeigen, dass als Folge ausgerechnet sie ihr Verhalten ändern und sich zum Teil aus dem öffentlichen Leben zurückziehen. Dem müssen wir entschieden entgegenwirken.
SPD-Politikerin Eichwede: „Sehen doch, dass es eine Lücke im Strafrecht gibt“
Wie?
Nicht die Opfer sollten ihr Verhalten ändern, sondern die Täter. Deswegen treten wir als SPD-Bundestagsfraktion dafür ein, einen neuen Straftatbestand gegen verbale sexuelle Belästigung – das sogenannte „Catcalling“ – zu schaffen. Das Strafrecht ist ein scharfes Schwert, keine Frage, deswegen müssen wir grundsätzlich vorsichtig sein, wenn wir neue Straftatbestände diskutieren. Hier aber haben wir ohne Zweifel ein strafwürdiges Verhalten und durch die Gesetzeslücke einen untragbaren Zustand, der korrigiert werden muss.
Andere Länder sind da schon weiter: In Frankreich oder Portugal gibt es etwa Geldstrafen für Catcalling, in Spanien sind auch Haftstrafen möglich. Was schwebt Ihnen vor?
Ich könnte mir vorstellen, zunächst mit einer Geldstrafe anzufangen – solche Fragen müssen aber in einem Gesetzgebungsverfahren geklärt werden. Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, eine Modernisierung des Strafgesetzbuches anzugehen und zu schauen, wo es Anpassungsbedarf gibt. Aus unserer Sicht gehört verbale sexuelle Belästigung dazu.
Erst im Februar ist eine Initiative Niedersachsens im Bundesrat gescheitert, „Catcalling“ als Straftat im Strafgesetzbuch festzuschreiben.
Wir sehen doch, dass es eine Lücke im Strafrecht gibt. Das sagen auch Wissenschaftlerinnen und Juristinnen außerhalb der Politik. Es geht hier um erhebliche, gezielte sexuelle Belästigung, wie in dem Fall des elfjährigen Mädchens. Das können wir als Gesellschaft nicht tolerieren. Es geht nicht darum, ungewollte Komplimente unter Strafe zu stellen, auch wenn diese nicht immer schön sind. Die Sorgen, die hier manche möglicherweise haben – von wegen, man dürfe dann gar nichts mehr sagen – sind völlig unbegründet. Eine solche Polemik wird dem Thema nicht gerecht.
Studien zufolge sind 97 Prozent der Täter von „Catcalling“ Männer. Kann ein neuer Straftatbestand strukturelle Probleme lösen?
Ein Straftatbestand kann nur ein Mosaikstein sein, aber Fehlverhalten muss Konsequenzen haben. Zumal daraus ein gesellschaftlicher Diskurs erwachsen kann, ein Hinterfragen: Warum ist eine Beleidigung strafbar, verbale sexuelle Belästigung aber nicht? Diese Diskussion ist wichtig, denn verbale Gewalt ist psychische Gewalt – und eine Vorstufe zu körperlicher Gewalt.
Sind Opfer sexueller Übergriffe denn grundsätzlich ausreichend geschützt? In Deutschland gilt seit 2016 eine „Nein heißt Nein“-Regelung (§ 177 Abs. 1 StGB), mehrere EU-Länder sind längst zum „Nur Ja heißt Ja“-Modell übergegangen …
Ich persönlich würde eine „Nur Ja heißt Ja“-Regelung auch in Deutschland befürworten, weil es Beweisfragen erleichtern würde. Die handelnden Personen müssen wissen, dass sie einvernehmlich handeln. Bei der „Nein heißt Nein“-Regelung muss das Opfer Ablehnung zeigen. Das kann strafrechtliche Konsequenzen bei Nicht-Ablehnung, etwa aus Furcht oder Resignation des Opfers, erschweren. Der Fall Pelicot sollte uns auch in Deutschland zu denken geben. Leider sehe ich derzeit keine politische Mehrheit im Deutschen Bundestag dafür, auf das Zustimmungsmodell zu wechseln.
„Da haben wir in der Tat viel Luft nach oben“
Insbesondere Frauen sind zunehmend sexualisierten Angriffen und Hass ausgesetzt. Die Meldestelle Antifeminismus zählte 2024 über 650 Meldungen, davon wurden 558 Vorfälle als antifeministisch eingestuft – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?
Die Zahlen sind erschreckend. Auch die Queer-feindlichen Vorfälle haben demnach enorm zugenommen. Wir erleben seit Jahren eine grundsätzliche Verrohung in der Gesellschaft, beginnend bei der Sprache. Vor allem im digitalen Raum nimmt die Hemmschwelle ab, weil es sich anonym gut hetzen und hassen lässt. Deshalb sind zum Beispiel echte Räume, in denen sich Menschen wieder begegnen und in die Augen schauen, so wichtig – auch und gerade im ländlichen Raum.
Rund 30 Prozent der Meldungen bezogen sich auf den digitalen Raum. Fehlt es dort an konsequenter Rechtsdurchsetzung?
Da haben wir in der Tat viel Luft nach oben. Im Sommer 2024 hat die Ampel-Koalition dafür gesorgt, dass Strafanträge auch digital gestellt werden können. Das war wichtig, um Hemmschwellen für Opfer abzubauen. Nun müssen wir dringend ein digitales Gewaltschutzgesetz auf den Weg bringen. Auch im digitalen Raum müssen klare Verhaltensregeln durchgesetzt und Opfer geschützt werden.
Inwiefern?
Durch das digitale Gewaltschutzgesetz sollen Betroffene vor Gericht einfacher gegen digitale Gewalt vorgehen könne und die Sperrung anonymer Hass-Accounts mit strafbaren Inhalten soll ermöglicht werden.
Für Aufsehen sorgt derzeit auch der Fall der Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich, die mithilfe des Selbstbestimmungsgesetzes die Justiz narrt und offenbar darauf setzt, durch einen Geschlechterwechsel eine Haftstrafe im Frauengefängnis absitzen zu können. Muss das Gesetz reformiert werden?
Die Justiz ist im vorliegenden Fall voll handlungsfähig. Die Bundesländer sind für die Justizvollzugsanstalten zuständig und können Regelungen anwenden, die diesem offensichtlichen Missbrauch entgegenwirken. Wegen eines Einzelfalls grundsätzlich an das Gesetz zu gehen, halte ich für falsch. Wir haben keinen Anlass, über die im Koalitionsvertrag bereits vereinbarte Evaluierung hinauszugehen.
Das Gesetz sollte eine niedrigschwellige geschlechtliche Selbstbestimmung ermöglichen, wird nun aber offenkundig missbraucht. Wie wollen Sie das verhindern?
Noch mal: Ein Missbrauch kann in diesem Fall ausschließlich von den Ländern verhindert werden, weil es darum geht, wie die Justizvollzugsanstalten damit umgehen. Einige Länder haben in diesem Bereich schon entsprechende Regelungen, andere nicht. Auch wenn der Geschlechtseintrag in diesem Fall „weiblich“ ist, gibt es Möglichkeiten, in eine andere Justizvollzugsanstalt zu überweisen. Aufgrund von Einzelfällen nun eine gesamte Gruppe von Menschen zu diskriminieren, löst das Problem nicht und ist mit uns nicht zu machen.